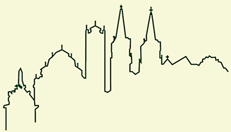|
» Zwischen den Stadtbränden 1616 und 1842 «

DAS RATHAUS UM 1830
Aus dem Souvenirblatt von 1884
Sammlung: © Dr. Manfred Schollmeyer, Oschatz

DER NEUMARKT UM 1840
Blick
auf die West- und Nordseite mit dem Rathaus, St. Aegidien,
der »Alten Wache« und dem »Gasthaus zum Schwan«. Nachdem der
Stadtrat das Stadthaus (Vogtshof am Kirchplatz 1) nicht
mehr nutzte, wurde am Neumarkt 1477 ein Rathaus gebaut, welches aber
offenbar den Anprüchen bald nicht mehr genügte.
Nach Abriss des alten Gebäudes baute man an gleicher Stelle
1538/1546 ein neues Rathaus nach den Entwürfen von Bastian
Kramer, wie es hier auf der Zeichnung von Julius Möckel zu sehen
ist. Aus dem Souvenirblatt »Oschatz – seine Kirchen und Hauptgebäude«:
gezeichnte von Julius Möckel; Lithographie von Renner und Ketzchau,
Dresden; Verlag Hermann Schmidt, Dresden.
Sammlung: © Dr. Manfred Schollmeyer, Oschatz

DER NEUMARKT, UM 1840
mit Blick von Westen auf den schon 1443 erwähnten »Gasthof
zum Goldenen Stern«. Im Vordergrund der Marktbrunnen, erbaut 1588/1589
vom
Leipziger Steinmetz Gregor Richter. Das »Gasthaus zum Schwan« und das
seit 1616 beurkundete »Alte Amtshaus« sind an der Nordseite des
Neumarktes zu
sehen. Aus dem Souvenirblatt »Oschatz – seine Kirchen und
Hauptgebäude«; gezeichnet von Julius Möckel; Lithographie von Renner und
Ketzschau,
Dresden; Verlag Herrmann Schmidt, Dresden.
Sammlung: © Dr. Manfred Schollmeyer, Oschatz

DER NEUMARKT, UM 1840
An
der Südseite (links) ist die seit 1647 priviligierte Löwenapotheke
dargestellt. An der Nordseite des Neumarktes ist das »Gasthaus zum
Schwan« zu sehen, das 1458 erstmals im Stadtbuch eingetragen ist.
Lithographische Anstalt Luis Klemich, Dresden; Verlag Oldecops Erben,
Oschatz.
Quelle: © Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

DER NEUMARKT
VOR DEM STADTBRAND 1842
Unterhalb der Kirche,
teilweise von einem Baum verdeckt, sieht man die »Alte Wache«. Erstmalig
1266 wurden hier 18 zinspflichtige Fleischbänke im Besitz der Kirche
erwähnt. Ab 1842 kaufte die Stadt die Fleischbänke auf und vermietete
sie an das Fleischerhandwerk. Vom Stadtbrand 1616 vernichtet, wurde das
Gebäude 1623/1625 neu gebaut. Ab 1676 unterhielten die in Oschatz und
Umgebung stationierten Soldaten die Hauptwache vor dem Haus. In den
Räumlichkeiten waren später zeitweilig eine Christbaumschmuckfabrik und
bis 1945 das Museum des Vereins für Orts- und Volkskunde untergebracht.
Seit 1927 befindet sich die Sparkasse in der »Alten Wache«. Künstler
unbekannt.
Sammlung: © Dr. Manfred Schollmeyer, Oschatz

SCHÜTZENAUFZUG AUF DEM NEUMARKT
VOR DEM STADTBRAND 1842
mit dem in Oschatz stehenden »Ersten Sächsischen Schützenbataillon«.
Künstler unbekannt
Quelle: © Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

DER ALTMARKT, UM 1827.
mit
dem »Gasthof zum Goldenen Löwen« und dem »Gasthof zum Weißen Roß«. Im
Vordergrund ein Aufzug des in Oschatz stehenden »Ersten Sächsischen
Schützenbataillons«. Künstler unbekannt..
Quelle: © Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

DER ALTMARKT, UM 1840.
Der Altmarkt entwickelte
sich im 12. Jahrhundert auf der Flur des ehemaligen slawischen Dorfes
Praschwitz und stellt die Wiege der Stadt Oschatz dar. Der Ausbau der
Verkehrswege und des Fernhandels beeinflussten die Entwicklung des
Altmarktes vom Stapel- und Rastplatz der Händler zu einer vorstädtischen
Siedlung. An der rechten Marktseite erkennt man den »Gasthof zum
Goldenen Löwen«, den »Gasthof zum Weißen Roß« und Scheumanns Gässchen
(Pfeil).
Aus »Sachsens Kirchengalerie«.
Verlag Herrmann Schmidt, Dresden; Druck Ernst Blochmann, Dresden 1840
Gezeichnet von Julius Möckel, Lithographie von Renner und Ketzschau,
Dresden
Sammlung: © Dr. Manfred Schollmeyer, Oschatz

DIE STADTKIRCHE ST. AEGIDIEN, UM 1840
vermutlich
im 12. Jahrhundert erbaut und dem heiligen Aegidius, dem Schutzpatron
der Rodungs- und
Neusiedler, geweiht. Die Kirche ist das älteste Kirchengebäude der
Stadt. Nach der Zerstörung durch die Hussiten 1429 wurde das katholische
Gotteshaus
ab 1443 im gotischen Stil neu erbaut. Nach der Reformation 1539
übernahm die evangelisch-lutherische Gemeinde die Stadtkirche.
Links: Lithographie
gedruckt und verlegt bei Friedrich Oldecops Erben, Oschatz 1872
Sammlung: © Horst Kohl, Rio de Janeiro
Rechts: Aus dem Souvenirblatt »Oschatz – seine Kirchen und
Hauptgebäude« Gezeichnet von Julius Möckel; Lithographie von Renner und
Ketzschau,
Dresden; Verlag Herrmann Schmidt, Dresden
Sammlung: © Dr. Manfred Schollmeyer, Oschatz

DIE FRIEDHOFSKIRCHE ST. GEORG, UM 1840
Von Bedeutung sind der geschnitzte Flügelaltar mit der heiligen Maria auf einer Mondsichel aus dem
16. Jahrhundert und die Grabmale aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, die das Innere und die Außenansicht der Kirche schmücken.
Aus
»Oschatz – seine
Kirchen und Hauptgebäude« Verlag: Herrmann Schmidt, Dresden, Druck:
Ernst Blochmann, Dresden, 1840. Gezeichnet von Julius Möckel;
Lithographie von
Renner und Ketzschau, Dresden.
Quelle: © Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

DIE FRIEDHOFSKIRCHE ST. GEORG,
UM 1840
auch »Bergräbniskirche« und
»Gottesackerkirche« genannt, wurde 1583/1587 auf dem Gelände der zum
Georgen-Hospital gehörenden Kapelle
erbaut. Links erkennt man die 1826/1827 erbaute Schafwollspinnerei
und rechts neben der Kirche die »Totenschänke« sowie die
Schankwirtschaft »Tivoli« in der Dresdener
Straße. Im Vordergrund eine Kursächsische Postdistanzsäule.
Aus dem Souvenirblatt » Oschatz – seine Kirchen und Hauptgebäude«. Gezeichnet von Julius Möckel;
Lithographie von Renner und Ketzschau, Dresden; Verlag: Herrmann Schmidt, Dresden.
Sammlung: © Dr. Manfred Schollmeyer, Oschatz

DIE KLOSTERKIRCHE,
UM 1840
auch unter dem Namen »Unser
lieben Frauen Kirche und »Marienkirche« bekannt, ist sie das letzte
Bauwerk des 1228 gegründeten
Franziskanerklosters. Das Gotteshaus wurde 1246/1248 erbaut. 1429 von
den Hussiten niedergebrannt und bis 1484 wieder aufgebaut. Seit der
Einführung der Reformation 1539
wurde die Klosterkirche nur noch teilweise kirchlich genutzt.
Aus dem Souvenirblatt » Oschatz – seine Kirchen und Hauptgebäude«. Gezeichnet von Julius Möckel;
Lithographie von Renner und Ketzschau, Dresden; Verlag: Herrmann Schmidt, Dresden.
Quelle: © Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

DIE STADTKIRCHE UND DER VOGTSHOF,
UM 1840
Der große Stadtbrand um 1616
hatte auch das Gotteshaus sehr zerstört. Auf dieser Zeichnung von Julius
Möckel ist der 1622 eingeweihte
Neubau, wie er bis zum Stadtbrand von 1842 das Stadbild prägte, zu
sehen.
Der Vogtshof (oben rechts herausgehoben), um 1200 erbaut und
wohl das älteste Haus der Stadt
Oschatz. Nach neuesten denkmalpflegerischen Untersuchungen soll es
sich bei dem Vogtshof auch um das älteste Steinhaus in Sachsen und
Mitteldeutschland handeln, wenn man
von Kirchen und Burganlagen absieht. Einst wurde das Gebäude als
Rathaus, Stadtgerichtshaus, adliges Freihaus, Tuchmacherhaus und
Wohnhaus genutzt.
Aus »Sachsens Kirchengalerie«. Verlag Herrmann Schmidt, Dresden; Druck: Ernst Blochmann, Dresden, 1840. Gezeichnet von Julius Möckel,
Lithographie von Renner und Ketzschau, Dresden
Sammlung: © Dr. Manfred Schollmeyer, Oschatz; Bildbearbeitung Dr. Thoralf Schollmeyer, Kiel
weiter
Die Lage der Stadt Oschatz
Die Wallanlagen der Stadt
Die Reformation in Oschatz
Zwischen den Stadtbränden 1616 u. 1842 I
Zwischen den Stadtbränden 1616 u. 1842 II
Zwischen den Stadtbränden 1616 u. 1842 III
Der Stadtbrand am 7. September 1842
Ansichten nach dem Stadtbrand 1842 I
Ansichten nach dem Stadtbrand 1842 II
Ansichten nach dem Stadtbrand 1842 III
Die Oschatzer Stadtviertel und Vorstädte
Die Oschatzer Industrie und Landwirtschaft
nach oben
|